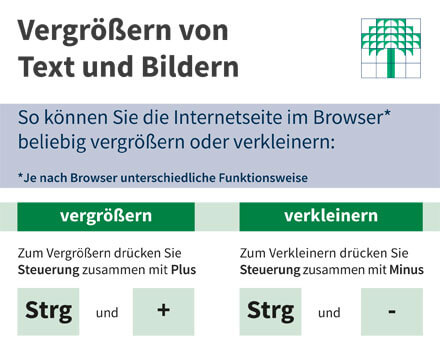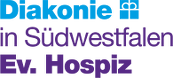„Dann weiß du: Das ist die Endstation“
"Sie lebt ihr Leben wie eine Kerze im Wind" – diese (übersetzte) Liedzeile aus Elton Johns "Candle in the Wind" bringt Sabines Lebensphilosophie auf den Punkt. In einem Kinderheim aufgewachsen, wollte die Siegenerin ihr Leben in vollen Zügen auskosten. Sie arbeitete, um anschließend Zeit und Geld zu haben, die Dinge auszuprobieren, die ihr Spaß machten, die sie reizten, die sie herausforderten: fremde Länder kennenlernen, Tiere züchten, Zeit mit interessanten Menschen verbringen. Ende 2015 dann der Schock. Bei Sabine wird eine schwere Krankheit diagnostiziert. Die letzte Zeit ihres Lebens verbringt die 55-Jährige nun im Ev. Hospiz Siegerland.
Manchmal arbeitete Sabine in zwei oder drei Jobs gleichzeitig, um ihren nächsten Traum zu verwirklichen. Arbeiten, das bedeutete für sie Umgang mit Menschen – als Friseurin, als Diätassistentin, als Diabetesberaterin, als Altenpflegerin. Sie lebte an den unterschiedlichsten Orten. Allerdings hielt sie es nie lange an einer Stelle aus. Lediglich als ihre Zwillinge 1989 zur Welt kamen, schaltete sie einen Gang herunter.
Ungarn fürs Herz, die Schweiz fürs Geld und Deutschland für die Sicherheit –mit diesem Dreiklang lässt sich Sabines Leben der vergangenen Jahre zusammenfassen. Sie erzählt: "In Ungarn hatte ich ein Haus, dort züchtete ich Tiere, genoss mein Leben. Ich spreche kein Wort ungarisch, obwohl ich dort jahrelang ein Haus hatte." Ihre Wahl fiel auf dieses Land, da sie im Internet festgestellt hatte, dass es dort sehr wenig Bürokratie gibt – "genau richtig für mich". Zwischendurch ging Sabine in die Schweiz, um Geld zu verdienen. Sie arbeitete als Einzelbetreuerin, pflegte Senioren, führte ihnen den Haushalt und begleitete auf Wunsch auch beim Sterben. "In Deutschland mietete ich zeitgleich eine kleine Wohnung, das gab mir das Gefühl von Sicherheit", erzählt die 55-Jährige.
Ende 2015 brach sie ihre Zelte in Ungarn und der Schweiz ab. Sie wollte eine Zeit lang in Deutschland leben, näher bei ihrer Tochter und ihrem Sohn sein. Während des Umzugs spürte Sabine, dass mit ihrem Körper etwas nicht stimmte. Sie erschlaffte schneller, fühlte sich oft müde und war nicht so belastbar, wie sie es gewohnt war. Sie beruhigte sich mit dem Gedanken an Überanstrengung. Doch ob sie wollte oder nicht: Sie musste sich eingestehen, dass sich ihr Zustand zusehends verschlechterte. Vor ihren Kindern konnte sie das jedenfalls nicht verbergen. Tochter und Sohn drängten die Mutter besorgt, zum Arzt zu gehen. Dem Besuch beim Hausarzt folgte die umgehende Einweisung in eine kardiologische Klinik. Die Diagnose war niederschmetternd: Ihr Herz arbeitete nur noch zu 15 Prozent, eine Aussicht auf Besserung gab es nicht. Der Therapievorschlag lautete: Medikamente, die Implantation einer Kombination aus Herzschrittmacher und Defibrillator sowie eine Herztransplantation, sobald ein geeignetes Spenderherz gefunden sei. Sabine, ganz die Kämpferin, die sie ein Leben lang war, konnte nicht fassen, was da in ihrem Körper geschah. "15 Prozent Herzleistung bei einem Durchschnittspatienten, das bedeutet bei mir mindestens 30 Prozent und damit kann ich gut leben. Den Rest besorgt dann die Therapie", tröstete sie sich. Und erneut musste sie einsehen, dass sie sich getäuscht hatte. Ihr Herz wurde schwächer, trotz der Medikamente, deren Nebenwirkungen sie zudem unterschätzte: Übelkeit, Brechreiz, extremer Husten und verklebte Bronchien gehörten fortan zu ihrem Alltag. "Wenn du mit Hustenreiz und verstopften Bronchien im Bett sitzt und keine Luft mehr bekommst, dann kannst du schon mal das Ersticken üben", erinnert sie sich sarkastisch. Von den Ärzten fühlte sie sich in dieser Situation unverstanden: Sie verschrieben ein Medikament nach dem anderen und meinten, die Nebenwirkungen würden schon nachlassen. Neben den belastenden Begleiterscheinungen der Therapie musste Sabine einen weiteren Tiefschlag verarbeiten: "Ich konnte meinem körperlichen Verfall quasi zusehen. Meine Arme, meine Beine, alles wurde immer dünner. Ich hatte das Gefühl, Stück für Stück zu verschwinden. Das war zu viel für mich. Ich wollte mich dagegen auflehnen. Jedoch wusste ich nicht wie. Ich war mein Leben lang ein Adrenalinjunkieund jetzt sollte ich langsam dahin vegetieren – alles in mir drin schrie: nein, nein, nein! Da wurden der Herzschrittmacher und der Defibrillator in meiner Brust zum Fremdkörper; mehr noch: zum Feind, den ich so schnell wie möglich loswerden musste. Wenn mein Herz aufhört zu schlagen, dann soll es auch zu Ende sein." Doch das implantierte Gerät abzuschalten, gestaltete sich schwieriger als Sabine gedacht hatte. Zahllose Gespräche mit unterschiedlichen Ärzten und Psychologen wurden terminiert, die Klinik berief ein Ethikkonsil ein und Sabine wurde immer wieder vertröstet. Die Patientin fühlte sich um ihr Recht auf Selbstbestimmung betrogen. In ihrer Verzweiflung schaltete sie einen Anwalt ein. Nach monatelangem Kampf wurde ihre Entscheidung endlich aktzeptiert und das Implantat ausgeschaltet. Die Medikamente hatte sie längst abgesetzt.
Während dieser Phase diskutierte siemit ihren Kindern und Freunden intensiv das Thema Sterbehilfe und auch Selbstmord angesichts einer unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit. Als Frau, die jahrelang in der Schweiz gearbeitet und dort auch Sterbende betreut hatte, wusste sie, wovon sie sprach. Dass diese Option für sie letztlich nicht in Frage kam, lag vor allem an der Vorstellung, was sie den Hinterbliebenen, insbesondere ihren Kindern, antun würde. Ihre Zwillinge konfrontierten sie auch mit dem Vorschlag, in ein Hospiz uimzuziehen. Eine Idee, die Sabine wohl nie gekommen wäre. Nach einigem Nachdenken willigte sie ein.
Der Kontakt zum Ev. Hospiz Siegerland wurde unbürokratisch hergestellt. Sabine rechnete damit, dass nach drei oder vier Wochen ein Platz für sie frei sein würde. Als der Anruf schon nach zwei Wochen kam, war sie überrascht, aber dennoch bereit umzuziehen. "Wenn du ins Hospiz gehst, weißt du, das ist die Endstation, da kommst du nicht mehr raus. Dann willst du von allem Abschied nehmen. Im Nachhinein denke ich, es war besser, dass ich nur ein paar Tage und keine Wochen dafür hatte", beschreibt sie den Tag ihres Einzugs.
Im Hospiz der Siegener Diakonie angekommen, wird Sabine überrascht. "In meiner Vorstellung war ein Hospiz eine Sterbefabrik und ich ging davon aus, jetzt hast du es schnell hinter dir. Weit gefehlt. Ich hätte nie gedacht, dass sich andere Menschen mal so liebevoll um mich kümmenr würden", schildert sie.
Sabine genießt den Kontakt mit ihren Mitbewohnern, die Gespräche mit deren Angehörigen im Wohnzimmer oder mit ihren Zwillingen im Wintergarten zu sitzen. "Besonders wichtig ist mir jedoch die Gewissheit, dass ich im Hospiz gut aufgehoben bin, wenn die Krankheit mir noch stärker zusetzt, wenn mein Herz noch schwächer une die Atemnot größer wird", betont sie und ergänzt: "Und ich weiß, dass es hier liebe Menschen gibt, die mir in meiner Not helfen und für meine Tochter und meinen Sohn da sein werden, wenn ich gegangen bin."
___________________________________________________________________________
„Ich habe ein echtes Zuhause gefunden“
Zwei Kleinkinder, lachend, mit grün-gestrickten Froschmützen auf dem Kopf: Mit diesem Anblick wacht Helene Walter, die eigentlich anders heißt, aber ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, jeden Morgen auf. Das fröhliche Duo, ihre Urenkel, zieren nur eine von unzähligen Fotografien, die Helene Walter mit in das Evangelische Hospiz Siegerland gebracht hat. Hier verbringt die 82-Jährige ihren Lebensabend: „An diesem Ort habe ich ein echtes Zuhause gefunden.“
Es ist ein langes, erfülltes Leben, auf das Helene Walter zurückblicken kann. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie ein Haus gebaut, drei Töchter großgezogen, die Enkelkinder mitversorgt und sich immer gekümmert, wenn in der Familie „Not an der Frau“ war. Doch im Jahr 1999 da war sie es selbst, die Hilfe brauchte. „Damals schlug der Krebs zum ersten Mal zu,“ erinnert sie sich. Diagnostiziert wurde ein Mammakarzinom. Die Ärzte behandelten brusterhaltend, setzten auf Bestrahlungen und eine Medikamententherapie. Lange ließ die Krankheit sie nicht zur Ruhe kommen. 2003 bereitete ein Lymphknoten Probleme. Einige Zeit ging ins Land, doch die Angst vor der Krankheit blieb. Bis zum Jahr 2016, wo die Befürchtungen traurige Gewissheit wurden: „Es hatten sich neue Metastasen gebildet. An Knochen und den Weichteilen“, so Helene Walter. Eine Operation war unmöglich. Helene Walter unterzog sich zunächst einer sogenannten Brachytherapie in Frankfurt, einer internen Form der Bestrahlung. Dann folgte die Gabe von Tabletten und Spritzen im Diakonie Klinikum Jung-Stilling. Doch ganz verschwand der Krebs seitdem nie. Helene Walter musste lernen, damit zu leben – bis heute.
Nicht die Krankheit, sondern ein ganz anderer Schicksalsschlag riss ihr 2017 den Boden unter den Füßen weg. Ihr Ehemann erkrankte schwer, „der Tod war eine Art Erlösung“, sagt sie leise. Doch sie vermisst ihn jeden Tag. Seine Fotografie war die erste, die sie in ihrem neuen Zuhause an der Wichernstraße aufstellte. 60 Jahre lang waren die Walters ein Paar. Kennengelernt haben sie sich an ihrem gemeinsamen Arbeitsplatz, sie im Verkauf, er in der Backstube: „Das war Liebe auf den ersten Blick.“ 15 Jahre alt war Helene Walter als es „funkte“. Die Liebe blieb bis zum letzten gemeinsamen Tag – und auch darüber hinaus.
„Die Töchter fingen mich damals auf, aber dann musste ich selber sehen, dass ich nicht abstürzte, depressiv wurde“, so die 82-Jährige heute. Geholfen durch schwere Zeiten hat ihr immer der Glaube: „Obwohl das nicht einfach war. Auf Gott zu vertrauen, wenn er einen so auf die Probe stellt.“
Aber Helene Walter hat es geschafft, sie kann wieder lachen. Auch mit den anderen Gästen, die mit ihr im Evangelischen Hospiz Siegerland leben: „Hier ist es wie in einer großen Familie.“ Die 82-Jährige liebt die Gespräche mit den anderen Gästen im Wohnzimmer der Einrichtung: „Wir reden über Gott und die Welt. Das tut gut, denn wir sitzen ja alle im selben Boot“, sagt sie. Und wenn sie sich doch einmal einsam fühlt, dann sind die Mitarbeiter sofort zur Stelle: „Die kommen auch in der Nacht. Setzen sich ans Bett und hören zu. Oder machen mir noch spätabends einen Apfelpfannkuchen.“ Zudem erhält die 82-Jährige täglich Besuch. Freunde und Nachbarn schauen regelmäßig vorbei. Zudem wechseln sich die Töchter und Schwiegersöhne täglich ab. Und auch die beiden Urenkel mit den Frosch-Strickmützen waren schon zu Besuch. „Da haben wir auf der Terrasse gesessen, Käfer beobachtet und sehr viel gelacht“, so die Uroma.
Ob sie Angst vor dem Tod hat? „Nein, denn ich weiß ja, was mich nach dem Tod erwartet. Da hilft mir das Gottvertrauen“, sagt sie. Wovor sie sich fürchtet sind die Schmerzen, die mit dem Sterben einhergehen. „Aber da nimmt mir hier jeder die Angst. Im Hospiz muss sich niemand quälen.“
Hospizleiter

Burkhard Kölsch
Telefon: 0271 333-6684
Telefax: 0271 333-6669
E-Mail-Kontakt
Postanschrift

Ev. Hospiz Siegerland
Wichernstraße 48
57074 Siegen
Anfahrt Google Maps